der Naturwissenschaften
und der Technik
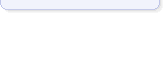
Aufgebrochen.
Übersicht | Inhalt | Vorwort | Links
Roland Hensel |
Vorwort des Autors
Hardcover-Ausgabe für 34,80 Euro zzgl. Versandkosten sicher vorbestellen auf
E-Book/PDF-Ausgabe für 29,80 Euro kaufen und herunterladen auf
Kostenlose Leseprobe herunterladen auf
Versand durch GNT Publishing, Berlin – Wir garantieren ein 60-tägiges Rückgaberecht für jede Bestellung bei originalverpackter Ware (Rücksendekosten trägt Kunde).
Weitere Infos auf der Website zum Buch: Aufgebrochen.org
Über Lebenswege von Menschen, die 1969 anfingen, in Jena Physik zu studieren
Dieses Buch zeichnet die Lebenswege höchst unterschiedlicher Menschen auf. Sie alle eint, dass sie 1969 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ein Physikstudium begannen und es erstmals in nur vier statt fünf Jahren abschließen mussten. Freude an Naturwissenschaften und Technik sowie Neugier auf kommende Herausforderungen waren wesentliche Triebfedern für diese sportliche politische Vorgabe. Es war eine Zeit, als Astronomie und Raumfahrt en vogue waren, Kernkraft als Energie der Zukunft galt und ein Studium der Naturwissenschaften beliebt war. Die jungen Leute entwickelten im Studium Beharrlichkeit, Durchhaltewillen und hohe Frustrationstoleranz – Eigenschaften, die sie auf ihrem späteren Berufsweg vielfach benötigen würden.
Alle waren sie Kinder der ersten Nachkriegsgeneration. Ihre Eltern hatten Krieg, Flucht und Vertreibung, Hunger und Not kennengelernt. Dies prägte deren Erziehungsstil. Und so entwickelten auch die Kinder Willenskraft und Resilienz, um Rückschläge zu bewältigen und Ziele zu erreichen. Aufgeben war keine Option. Wer zum Beispiel damals das Abitur ablegen wollte, hatte gleichzeitig auch einen Beruf zu erlernen. Und so wurden die künftigen Physiker zunächst Maurer, Weber, Elektriker, Schlosser oder Maschinenbauer, Molkereiarbeiter, Gärtner oder Krankenschwester. Die meisten der hier Porträtierten empfanden die Lehrzeit als Bereicherung.
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena war ein Vorreiter bei der Durchführung der 3. Hochschulreform der DDR. Um innerhalb von nun vier Jahren ein naturwissenschaftliches Studium mit dem Diplom abzuschließen, brauchte es einen heute kaum mehr nachvollziehbaren, streng getakteten Studienablauf. Dazu gehörte auch eine 70-Stunden-Woche von montags früh bis Samstagmittag.
Weil viele Studenten zu Studienbeginn noch keinen Wehrdienst abgeleistet hatten, wurden außerdem Wehr- und Zivilschutzdienst integraler Bestandteile des Studiums. Natürlich hatte jeder seine eigene Einstellung zum Staat und definierte für sich rote Linien, die er nicht überschreiten wollte. Und wer aus christlicher Überzeugung den Dienst an der Waffe verweigerte, wurde einfach exmatrikuliert.
Trotz des engen Zeitkorsetts organisierten die Physikstudenten ein Kulturpraktikum im Thüringer Wald, einen Physikerfasching in der Mensa, sie gründeten die bis zur Wende äußerst erfolgreiche Konzertreihe „Musik im Hörsaal“ und fuhren in den Sommerferien zusammen nach Bulgarien. Nicht alles war im Sinne der FDJ-Organisation und der Hochschulleitung. Doch Schwierigkeiten räumten sie entschlossen aus dem Weg. Auch das war wegweisend. Dies und das gemeinsame Zusammenleben auf engstem Raum in Studentenbaracken mit Vierbettzimmern prägten ein Gemeinschaftsgefühl, das bis heute gelebt wird und für heutige Verhältnisse ungewöhnlich ist.
Nach dem Studium wies die staatliche Absolventenlenkung – eine zentrale Zuweisungspraxis in der DDR – den frisch diplomierten Physikern Arbeitsstellen in Betrieben der gesamten DDR zu. Für treue Genossen unter den Hochbegabten vergab die Sektion Forschungsstipendien; alle anderen konnten sich an anderen Hochschulen oder Instituten bewerben, um zu promovieren oder habilitieren. Letztendlich arrangierte man sich, heiratete, wartete auf eine Wohnung und erzog seine Kinder. Nur wenige entschieden sich für einen anderen Weg. Sie sattelten um, ergriffen einen anderen Beruf oder verließen die DDR – teils durch Flucht, teils durch Ausreiseantrag.
1989 leitete der Fall der Mauer den Zusammenbruch der DDR ein. Dieses einschneidende Ereignis zerstörte bis dahin geradlinig verlaufende Karrieren. In strukturschwachen Gebieten gab es von einem Tag auf den anderen keine Arbeitsplätze mehr. Kombinate wie Carl Zeiss Jena, die Keramischen Werke Hermsdorf oder Robotron schickten Tausende von Mitarbeitern in die Arbeitslosigkeit. Forschungseinrichtungen wurden zerschlagen oder mussten sich mühsam an die nun herrschenden Marktbedingungen anpassen.
Während manche Physiker keinen Tag arbeitslos waren und ihre Arbeit fortsetzen konnten, hangelten sich andere von einer Weiterbildungsmaßnahme zur anderen, nur um am Ende wieder in der Statistik des Arbeitsamtes aufzutauchen. Freundschaften zerbrachen, weil Geheimnisse plötzlich öffentlich wurden. Alles wurde anders, selbst das Klingeln des Telefons. Wie viele Tränen in dieser Zeit flossen, weiß niemand. Und erst, als sich der Staub des Umbruchs gelegt hatte, sahen die Menschen wieder Licht am Ende des Tunnels.
50 Jahre nach ihrem Diplom ziehen 37 Physikerinnen und Physiker Bilanz. In den authentischen Porträts erlebt der Leser nicht nur die enorme Kraft und Durchhaltewillen jedes Einzelnen, sein Schicksal sowohl vor als auch nach der Wende mutig zu gestalten, sondern auch, wie ostdeutsche Forschung zwar weltmarktreife Produkte hervorbrachte, für deren Produktion aber durch Westembargo die Rohstoffe oder Spezialteile fehlten. Nach der Wiedervereinigung wurden in einer vielfach als „Kolonisierung“ empfundenen Entwicklung zahlreiche Ostbetriebe systematisch geschlossen. Hier wird deutlich, welches Know-how und Potenzial der Osten dem Westen schenkte – entgegen der bis heute weitverbreiteten Ansicht, dass die Transformation allein Westdeutschland zu verdanken ist.
Das Buch ist ein Geschenk von Naturwissenschaftlern an die heutige Jugend und ein Angebot nachzudenken, wie MINT-Fächer (Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften, Technik) wie beispielsweise Physik vielfältigste Berufswege öffnen – was auch in den nächsten 50 Jahren passieren mag.
Mein großer Dank gilt meinen Kommilitonen der „Matrikel 69“ der damaligen Sektion „Physik für den wissenschaftlichen Gerätebau“. Besonders überrascht war ich, wie viel Zustimmung ich für dieses Projekt erhielt und wie viel Vertrauen mir geschenkt wurde. Diese Offenheit hat mich tief berührt. Sie gab mir die Chance, dieses Stück Zeitgeschichte festzuhalten.
Gleichzeitig möchte ich mich bei der Kulturstiftung Thüringen bedanken, deren viermonatiges Stipendium im Jahr 2023 ein Ansporn war, diese Lebensgeschichten zu erforschen und zu erzählen. Nicht zuletzt gilt mein besonderer Dank dem Dreamteam aus Verleger Martin Barth und Buchgestalter Helmut Stabe. Nach langer Suche fanden hier Menschen zusammen, die sich sehr engagierten, dieses Buch zu einem Kunstwerk zu machen.
Dresden, im September 2025
Roland Hensel
